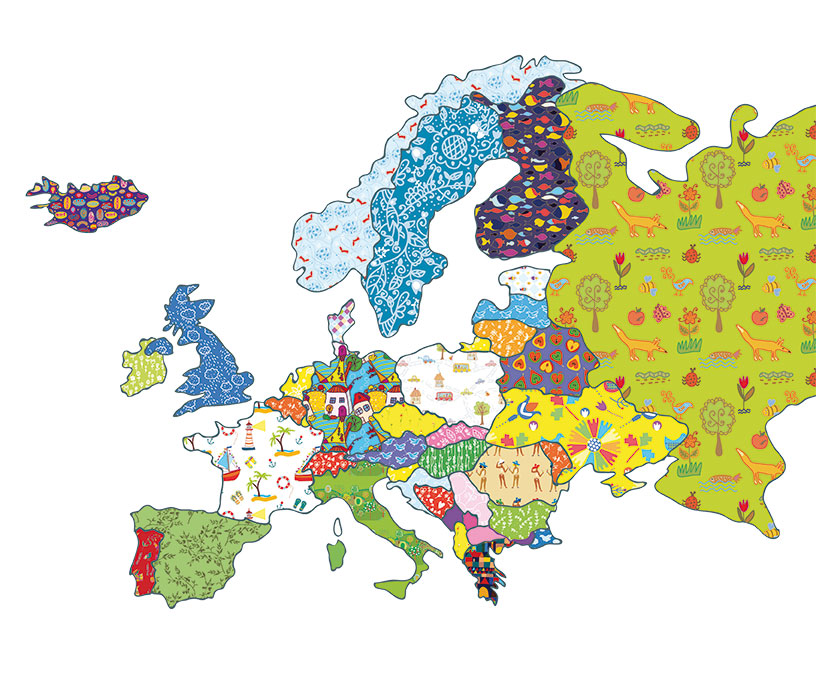Alles «great» - oder doch nicht?
Sie sprechen englisch? Sehr gut. Sie haben trotzdem manchmal Probleme, zu verstehen, was Kollegen aus den USA Ihnen sagen wollen? Kann passieren, denn im Land der unbegrenzten Möglichkeiten geht man sprachlich manches anders an.

Neulich in der Serie «Die Simpsons»: Mr. Burns, der Chef des Atomkraftwerks, feuert alle Mitarbeiter, um sie durch Roboter zu ersetzen. Homer Simpson geht daraufhin ins Büro seines Chefs, um ihm die Meinung zu sagen, und zwar so: «Erstens: Ich mag die neue Mikrowelle im Pausenraum – einfach auf ‹Popcorn› drücken und sie macht’s. Zweitens: Uns durch Roboter zu ersetzen, ist herzlos und ekelhaft! Drittens: Wie wär’s mit einer Abschiedsparty mit einem Karikaturisten? Das wär was für Kinder und Erwachsene. Ich fasse zusammen: Gut gemacht. – Wir hassen Sie. – Und: Denken Sie mal nach.»
Hat Homer Probleme dabei, sich bei seiner Argumentation auf das Wesentliche zu konzentrieren? Nein, das nennt man in den USA «Kiss-Kick-Kiss». Auf diese Methode wird gerne zurückgegriffen, wenn es etwas zu kritisieren gibt: zuerst etwas loben, dann das Problem ansprechen, um dann wieder versöhnlich abzuschliessen. Das soll den Kritisierten ermutigen, sich zu verbessern, statt sich angegriffen zu fühlen. Am Ende der besagten Simpsons-Folge stellt Mr. Burns übrigens alle Mitarbeiter wieder ein – allerdings nicht aufgrund von Homers Überzeugungsarbeit, sondern weil sich die Roboter in Killermaschinen verwandelt haben.
Feedback mit Zuckerguss
Auch wenn dieses Szenario in der Realität eher nicht zu befürchten ist, hat diese Art des Feedbacks doch ihre Tücken: «Wer damit nicht vertraut ist, läuft Gefahr, sich von den einführenden wohlwollenden Worten einlullen zu lassen und das eigentliche Feedback zu überhören», betont Christa Uehlinger, Intercultural Adviser und Inhaberin von christa uehlinger linking people (Coaching, Training, Beratung), Winterthur. In den USA ist es üblich, «sugarcoated messages», also «Botschaften mit Zuckerguss», zu senden. Ein bekanntes Beispiel dafür: nicht von «Problemen» sprechen, sondern erst einmal alles als «Herausforderung» («challenge») bezeichnen. «Worte wie ‹great› und ‹fantastic› fallen sehr oft. Für Schweizer tönt das oft etwas übertrieben», weiss Christa Uehlinger.
Negative Aussagen meidet man aber nicht nur in geschäftlichen Situationen, sondern generell. Christa Uehlinger erinnert sich an ein Gespräch mit einem amerikanischen Bekannten, der längere Zeit arbeitslos war, und wie er über seine Situation sprach: «Er sagte: ‹Ich habe gerade dort diese Option gehabt und da jene Option.› Niemals hätte er gesagt: ‹Ja, es ist gerade sehr schwer für mich.›»
Was hast du erreicht?
Dass man in den USA den Dingen gerne einen schönen Anstrich gibt, kann man auch bei amerikanischen Bewerbungen beobachten. Ein rein tabellarischer Lebenslauf, aus dem kurz und bündig die wichtigsten Informationen herauszulesen sind, würde in den USA nicht ankommen, berichtet Christa Uehlinger: «Man beschreibt darin möglichst ausführlich nicht nur, welche Position man zuvor in welchem Unternehmen innehatte, sondern vor allem das dabei Erreichte – womöglich sogar, was der eigene Einsatz dem Unternehmen an Umsatzsteigerungen eingebracht hat.»
Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten kann jeder etwas erreichen: Von dieser Vorstellung beflügelt ist auch die weite Verbreitung von politisch korrekten Ausdrücken, die verhindern sollen, dass jemand diskriminiert wird – zumindest formal. Dass für den Posten eines Vorsitzenden nicht mehr ein «chairman», sondern eine «chairperson» gesucht wird, mag noch verständlich sein. Etwas skurril kann es für Aussenstehende allerdings anmuten, wenn zum Beispiel Übergewichtige als «differently sized» oder Blinde als «visually challenged» bezeichnet werden.
Komm zum Punkt
Amerikaner mögen es allerdings nicht immer wortreich. «In E-Mails ist es wichtig, schnell auf den Punkt zu kommen, denn Zeit ist Geld», betont Christa Uehlinger. Wer in ausufernden E-Mails voller höflicher Floskeln detailreich beschreibt, welche Wünsche er an den amerikanischen Partner hat, werde vermutlich nicht weit kommen: «Lange E-Mails lesen Amerikaner meist nicht zu Ende. Besser ist es daher, wenn man kurz und prägnant schreibt», erklärt Christa Uehlinger und rät ausserdem: «Hat man mehrere Anliegen, können mehrere separate Mails eher zum Ziel führen.»
Missverständnisse lauern bei der Art, wie sich Amerikaner anreden: Zum einen kennt das Englische kein «Sie», zum anderen geht man nicht nur bei Kollegen, sondern auch bei Vorgesetzten und Geschäftspartnern sehr schnell zur Anrede mit dem Vornamen über. «Das kann so wirken, als duzten sich alle und als wären dementsprechend die Hierarchien sehr flach – das ist aber auf den zweiten Blick nicht so», weiss Christa Uehlinger. Dass jemand höher gestellt sei, werde dadurch deutlich, wie man sich in seiner Gegenwart verhalte: etwa, dass man nicht vor dem Chef in den Feierabend gehe oder sich beim Geschäftsessen erst hinsetze, wenn auch er sitze. Bei der Anrede in E-Mails kann es wiederum zum umgekehrten Missverständnis kommen: Beginnt ein Amerikaner ein Mail nur mit dem Vornamen des Empfängers ohne ein ‹Dear› davor, bedeutet das nicht etwa, dass er verärgert ist. Im Gegenteil: Das ist die Anrede, die am stärksten persönliche Nähe ausdrückt.
Freie Tage sind rar
Amerikaner sind oft verblüfft, wie viel Ferien Schweizer haben: Während hierzulande die meisten vier oder fünf Wochen pro Jahr frei haben, müssen sich Amerikaner meist mit zwei Wochen zufriedengeben. In vielen amerikanischen Unternehmen ist es zudem sogar üblich, dass Angestellten nur eine bestimmte Anzahl von Krankheitstagen eingeräumt werden. Für Amerikaner ist deshalb die Art, wie anderswo Ferien gewährt werden, manchmal nicht nachvollziehbar. Christa Uehlinger berichtet von einem Erlebnis, das ihr einer ihrer Kunden schilderte: «In seinem Unternehmen war eine Videokonferenz mit den amerikanischen Partnern anberaumt und einer seiner Schweizer Kollegen war nicht dabei, weil er in den Ferien war. Ein amerikanischer Kollege bemerkte daraufhin: ‹Sie nennen es Ferien, wir würden es Arbeitslosigkeit nennen.›»
Selbst gesetzliche Feiertage sind in den USA nicht generell arbeitsfreie Tage, nur manche Arbeitgeber geben zum Beispiel am Veteranentag (11. November) oder am Präsidententag (dritter Montag im Februar) frei. Banken und Finanzdienstleister orientieren sich dabei meist an den Feiertagen, an denen die US-Börse geschlossen bleibt. Regierungsstellen und Ämter sind wiederum an allen gesetzlichen Feiertagen geschlossen. Nur zwei Daten sind bindend für alle: der amerikanische Nationalfeiertag am 4. Juli und der Weihnachtstag am 25. Dezember.
Gegen Jahresende nimmt aber oft der Elan bei der Arbeit deutlich ab. «In der Phase ab Thanksgiving Ende November bis Neujahr hin verlangsamt sich alles merklich», hat Christa Uehlinger beobachtet. Die wichtigsten Fortschritte eines gemeinsamen Projekts sollten also bis dahin unter Dach und Fach sein.
Arbeiten mit Partnern in den USA - so klappt's
- Be positive: Erfolge und Chancen werden herausgestellt, Kritik wird nett verpackt.
- Klappern gehört zum Geschäft: nicht allzu beeindruckt von vermeintlich überschwänglichen Lobeshymnen sein.
- Time is money: E-Mails kurz halten, um sicherzugehen, dass sie vollständig gelesen werden.
- Political Correctness wahren: Äussere Merkmale oder körperliche Behinderungen sind als Gesprächsthema tabu.
- Nicht witzig: In den USA wird sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sehr eng gefasst. Vermeintlich harmlose Komplimente oder Witze können unangenehm auffallen.
- That time of the year: Die wichtigsten Fortschritte in einem Projekt sollten bis Thanksgiving (4. Donnerstag im November) gemacht sein – danach schaltet man in den USA bis Neujahr einen Gang runter.