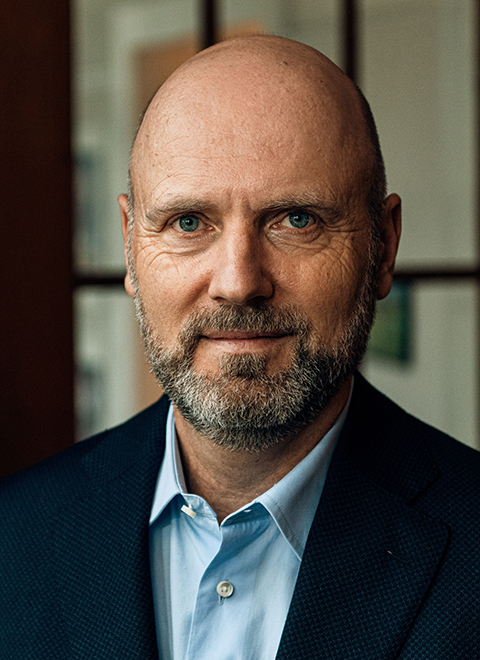Eine unbezahlbare Stütze für das Zusammenleben
Ohne das Engagement von freiwilligen Mitarbeitenden wären viele Angebote und Projekte von Non-Profit-Organisationen nicht möglich. Freiwilligenarbeit hat in der Schweiz eine lange Tradition und findet auch heute noch in grossem Umfang statt.

Foto: Charles DeLuvio / Unsplash
Sie reinigen Seeufer und Bäche, besuchen alte oder kranke Menschen, geben Flüchtlingen Deutschunterricht – ganz ohne Bezahlung. Freiwillig engagierte Personen sind für viele Non-Profit-Organisationen und öffentliche Dienste eine unerlässliche Ressource, und auch im Pflegebereich sowie bei der Nachbarschaftshilfe spielen sie eine wichtige Rolle: Ohne den Einsatz von engagierten Menschen sähe die Schweiz anders aus. Freiwilligenarbeit bildet die Grundlage für die Existenz zahlreicher Vereine und ist ein wesentliches Element für eine funktionierende Demokratie. Freiwillige leisten einen Beitrag für das Zusammenleben und übernehmen Verantwortung.
1. Formelle und informelle Freiwilligenarbeit
Freiwilligenarbeit meint eine Tätigkeit, die den Mitmenschen oder der Umwelt zugutekommt. Im Gegensatz zur Erwerbstätigkeit handelt es sich um unentgeltliche Einsätze, die ausserhalb der Kernfamilie stattfinden – somit zählt die ebenfalls unbezahlt geleistete Haus- und Familienarbeit nicht dazu. Freiwilligenarbeit kann informell geleistet werden, in Form von Nachbarschaftshilfe oder Unterstützungen im Freundeskreis.
Bei der formellen Freiwilligenarbeit handelt es sich indes um ein Engagement für eine Organisation, einen Verein oder eine öffentliche Institution. Beispiele dafür sind Sportvereine, Kirchen, Naturschutzorganisationen, Alters- und Pflegeheime, Hilfswerke etc. Das formelle Engagement wiederum wird unterteilt in allgemein freiwillige und ehrenamtliche Tätigkeiten. Bei Letzterem wird eine Person in ein Amt gewählt (Vorstandsmitglied eines Vereins, Mitglied einer Schulkommission etc.), wodurch der Verpflichtungsgrad bei dieser Tätigkeit höher ist im Vergleich zur Basisarbeit, die alle unentgeltlichen Aufgaben für eine Organisation meint.
2. Corporate Volunteering
Eine weitere Engagementform ist Corporate Volunteering. Dabei setzen sich Mitarbeitende im Namen ihres Unternehmens aktiv für ein gemeinnütziges Projekt ein. Die Rahmenbedingungen dieser betrieblichen Freiwilligenprogramme können sehr unterschiedlich sein: vom einzelnen Tag, an dem beispielsweise eine gesamte Abteilung bei einer Baumpflanzaktion mithilft, bis zu langjährigen Kooperationen mit Non-Profit-Organisationen.
Zusammen etwas bewegen
Die Anzahl freiwillig Engagierter ist in den letzten 20 Jahren stabil geblieben. Gemäss dem Bundesamt für Statistik gingen im Jahr 2020 41 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz ab 15 Jahren einer unbezahlten Tätigkeit nach; das sind rund 3 Millionen Menschen. Im Durchschnitt waren sie während 4,1 Stunden pro Woche freiwillig tätig.
Mit 32,5 Prozent engagierten sich deutlich mehr Freiwillige im informellen Bereich, der Anteil an der formellen Freiwilligenarbeit betrug 15,9 Prozent. Auffallend ist zudem, dass die Freiwilligenarbeit in Vereinen und Organisationen hauptsächlich von Männern und von Personen mit einer Ausbildung auf Tertiärstufe ausgeübt wird.
Im informellen Bereich engagieren sich vor allem Frauen im Alter zwischen 55 und 74 Jahren. Die meisten übernehmen Betreuungs- und Pflegeaufgaben für Angehörige wie Enkelkinder oder betagte Eltern. Die formelle Freiwilligenarbeit findet überwiegend in Sportclubs, im Kulturbereich oder in Spiel-, Hobby- und Freizeitvereinen statt.
Am meisten Freiwilligenarbeit wird in ländlichen Regionen der Deutschschweiz geleistet. Potenzial für die Übernahme einer Freiwilligentätigkeit gibt es insbesondere bei jüngeren Menschen, Personen aus der französischen und italienischen Schweiz, Stadtbewohnenden und Migrantinnen und Migranten.
Gründe, weshalb sich Menschen unentgeltlich für das Gemeinwohl einsetzen, sind vielfältig und haben sich in den letzten Jahren verändert. Altruistische Motive spielen zwar nach wie vor eine Rolle, jedoch rücken selbstbezogene Aspekte wie die Freude am Engagement oder das Erweitern von eigenen Kenntnissen vermehrt in den Vordergrund.
Bei den Freiwilligen, die für eine Organisation tätig sind, ist der Spass an der Tätigkeit das Hauptmotiv. An zweiter Stelle kommen die sozialen Aspekte: Die Freiwilligen möchten mit anderen Menschen zusammen sein, mit ihnen etwas bewegen und dabei andere unterstützen. Drei Viertel der informell Engagierten geben an, dass sie in erste Linie anderen Menschen helfen möchten, der Spass steht bei ihnen an zweiter Stelle.
Was Freiwillige wollen
Megatrends wie Individualisierung, Flexibilisierung und Digitalisierung führten in den vergangenen Jahren zu strukturellen Veränderungen in der Freiwilligenarbeit. So nahm beispielsweise das traditionelle Engagement mit langjähriger Bindung an eine Organisation deutlich ab. Insbesondere für junge Menschen steht nicht die Vereinszugehörigkeit im Zentrum, sondern das Thema, für das sie sich einsetzen.
So treten beispielsweise Kinder nicht mehr selbstverständlich in den Verein ein, in dem schon ihre Eltern aktiv waren, sondern es sind vermehrt befristete und unverbindliche Einsatzmöglichkeiten gefragt. Dieser Trend wird durch die steigende Mobilität noch verstärkt, vor allem der Jungen. Man verbringt seine Freizeit nicht mehr unbedingt dort, wo man arbeitet und wohnt.
Eine zentrale Voraussetzung der Freiwilligenarbeit ist, dass sie freiwillig und unentgeltlich erfolgt. Das bedeutet aber nicht, dass sie eine Selbstverständlichkeit ist. Es ist wichtig, dass das Engagement der Freiwilligen regelmässig verdankt und wertgeschätzt wird. Die Anerkennung und die Würdigung der Arbeit beeinflussen die Motivation der Freiwilligen und somit deren Bindung an eine Organisation massgeblich.
Um Menschen für ein Engagement gewinnen und halten zu können, braucht es eine Anerkennungskultur, die den Freiwilligen das Gefühl vermittelt, dass sie gebraucht werden und ihr Einsatz geschätzt wird. Diese Anerkennung kann beispielsweise eine persönliche Geburtstagskarte oder ein Dankesanlass sein. Auch die Möglichkeit einer Weiterbildung ist eine Form der Anerkennung.
Weitere Massnahmen können spezielle Kampagnen sein, mit denen die Freiwilligenarbeit in der Öffentlichkeit sichtbar gemacht wird, oder eine positive Berichterstattung in den Medien, indem zum Beispiel ein Verein, ein Projekt oder eine freiwillig engagierte Person porträtiert wird. Wichtig ist, dass die Wertschätzung sowohl auf organisationaler als auch auf gesellschaftlicher Ebene stattfindet. Denn Freiwilligenarbeit ist zwar unbezahlt, für das Zusammenleben aber von unbezahlbarem Wert.