Nachvertragliche Konkurrenzverbote
In gewissen Positionen können auch Assistenzen von Konkurrenzverboten betroffen sein. Wie damit umzugehen ist, erklären Nicolas Facincani und Hamide Miftari.
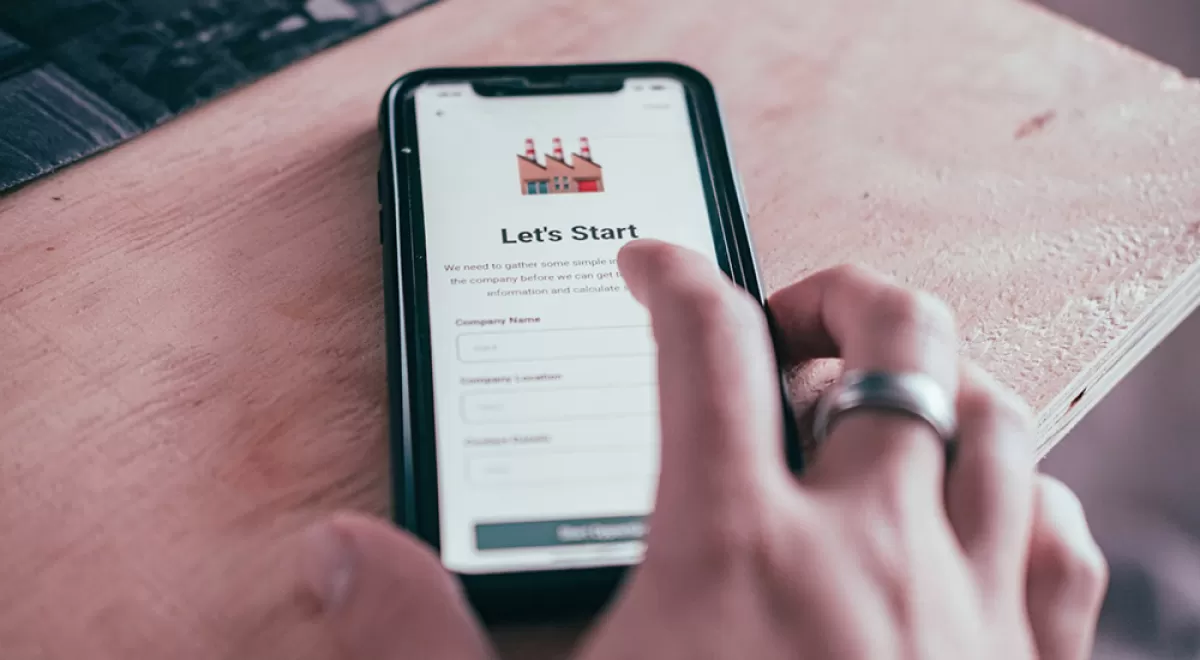
Foto: Unsplash
Die Vereinbarung eines nachvertraglichen Konkurrenzverbots sieht vor, dass sich Mitarbeitende nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Unterlassung konkurrenzierender Tätigkeiten für eine bestimmte Zeit verpflichtet. Insbesondere sei jede selbständige und unselbständige Tätigkeit in Unternehmen oder finanzielle Beteiligung an Unternehmen zu unterlassen, die im Wettbewerb mit dem Arbeitgebenden stehen (Art. 340 Abs. 1 OR). In einem solchen Fall sind jedoch die Schranken des Gesetzes zu beachten.
Voraussetzungen für die Gültigkeit des Konkurrenzverbots gemäss Art. 340 OR sind:
- Handlungsfähigkeit
- Einblick in Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse und in den Kundenkreis oder
- Schriftlichkeit der Vereinbarung über das Wettbewerbsrecht
Die fehlende Handlungsfähigkeit kann auch dann nicht behoben werden, wenn die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vorliegt.
Beim Einblick in den Kundenkreis oder in Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse muss die Möglichkeit der erheblichen Schädigung des Arbeitgebenden bestehen. Diese Möglichkeit ist dann nicht gegeben, wenn der Einblick in den Kundenkreis oder in Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nur gering ist. Hängt die Erbringung der Leistungen stark von den Fähigkeiten eines Arbeitnehmenden ab, sodass der Kunde diesen Fähigkeiten eine weit grössere Wichtigkeit beimisst als der Identität des Arbeitgebenden, so ist die Vereinbarung eines Konkurrenzverbots ungültig, auch wenn ein Einblick in den Kundenkreis erfolgt ist.
In Bezug auf Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse des Arbeitgebenden müssen diese spezifischen technischen, organisatorischen oder finanziellen Fragen betreffen, die im Interesse des Arbeitgebenden sind, diese geheim zu halten. Nicht erfasst sind allgemeine Berufserfahrungen oder Branchenkenntnisse.
Das Konkurrenzverbot muss schriftlich vereinbart werden, beispielsweise als Bestandteil des Arbeitsvertrages. Die Vereinbarung eines Konkurrenzverbots in einem Personalreglement, das selbst nicht unterzeichnet ist, reicht nicht aus. Weiter fällt ein Konkurrenzverbot dahin, wenn es im Rahmen einer Aufhebungsvereinbarung nicht mehr erwähnt wird, obschon es zu Beginn schriftlich vereinbart wurde. Gleiches gilt, wenn im Rahmen eines Abschlusszeugnisses die Formulierung «der Mitarbeitende verlässt uns ohne Verpflichtung» enthalten ist.
Schranken eines Konkurrenzverbots
Die Vereinbarung eines Konkurrenzverbots darf das wirtschaftliche Fortkommen eines Arbeitnehmenden nicht wesentlich behindern. Weiter bedarf es nebst dieser allgemeinen Schranke, noch einer Einschränkung in sachlicher, geographischer und zeitlicher Hinsicht:
- Sachliche Einschränkung: Das Konkurrenzverbot muss sich auf die konkrete Tätigkeit des Arbeitgebenden gemäss Arbeitsvertrag oder Stellenbeschreibung beschränken. Weiter ist gemäss Urteil des Bundesgerichts (4A_218/109) das Verbot «jeder konkurrenzierender Tätigkeit» für ein Konkurrenzverbot genügend konkret.
- Geographische Einschränkung: Das Konkurrenzverbot ist auf den Wirkungskreis des Unternehmens des Arbeitgebenden zu beschränken.
- Zeitliche Einschränkung: Grundsätzlich dauert das Konkurrenzverbot nicht mehr als drei Jahre. Unter besonderen Umständen kann es diese Dauer überschreiten, wobei in der Praxis das Konkurrenzverbot häufig auf maximal ein Jahr beschränkt wird.
Übermässiges Konkurrenzverbot
Gemäss Art. 340a Abs. 2 OR kann der Richter ein übermässiges Konkurrenzverbot unter Würdigung aller Umstände nach seinem Ermessen einschränken, wobei eine allfällige Gegenleistung für das Konkurrenzverbot mitberücksichtigt wird. Entscheidend ist, ob das Konkurrenzverbot das wirtschaftliche Fortkommen des Mitarbeitenden in einer Weise beeinträchtigt, die sich durch die Interessen des Arbeitgebenden nicht rechtfertigen lassen.
Wegfall des Konkurrenzverbots
- Gemäss Art. 340c OR fällt das Konkurrenzverbot dahin, wenn der Arbeitgebende nachweisbar kein erhebliches Interesse mehr hat, es aufrecht zu erhalten; oder
- Wenn der Arbeitgebende dem Arbeitnehmenden kündigt, ohne dass er ihm einen begründeten Anlass dazu gegeben hat; oder
- Der Arbeitgebende das Arbeitsverhältnis aus einem bei ihm liegenden Grund kündigt.
Rechtsfolgen bei Verletzung des Konkurrenzverbots
Verstösst ein Arbeitnehmender gegen das Konkurrenzverbot, so hat er dem Arbeitgebenden den daraus wachsenden Schaden zu ersetzen (Art. 340b Abs. 1 OR). Die Beweislast des Schadens obliegt beim Arbeitgebenden.
Sieht die schriftliche Vereinbarung eine Konventionalstrafe bei Übertretung vor, so ist diese vom Arbeitnehmenden geschuldet, allerdings bleibt er für weiteren Schaden dem Arbeitgebenden ersatzpflichtig. Die Bezahlung der Konventionalstrafe entbindet den Arbeitnehmenden hingegen von der weiteren Einhaltung des Konkurrenzverbots, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Das Gericht kann auch in diesem Fall, sofern diese als übermässig empfundene Konventionalstrafe angesehen wird, angemessen reduzieren.
Gemäss Art. 340b Abs. 3 OR kann der Arbeitgebende, sofern es besonders schriftlich vereinbart wurde, nebst einer Konventionalstrafe und dem Ersatz weiteren Schadens, zusätzlich die Beseitigung des vertragswidrigen Zustandes verlangen, sofern es das Verhalten des Arbeitnehmenden und die verletzten oder bedrohten Interessen des Arbeitgebenden rechtfertigen.
Sonderfälle
Die schriftliche Vereinbarung eines Konkurrenzverbots im Rahmen eines Lehrvertrages ist gemäss Art. 344a Abs. 6 OR nichtig. Eine entsprechende Vereinbarung würde die Lernenden im freien Entschluss über die berufliche Tätigkeit nach Beendigung der Lehre beeinträchtigen.
Bei den sogenannten freien Berufen, wie Ärzte, Rechtsanwältinnen, Architekten, Zahnärztinnen oder Ingenieure, geht die Rechtsprechung grundsätzlich von einer Unzulässigkeit des Konkurrenzverbots aus. Zudem ist die Lehre der einhelligen Auffassung, dass es auf die persönlichen Fähigkeiten ankommt und diese über Erfolg oder Misserfolg ausschlaggebend sind.
Auch bei anderen Berufsarten, wie Vermögensverwaltern, stehen die persönlichen Fähigkeiten des Arbeitnehmenden im Vordergrund, wobei stets auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalls abzustellen ist. Möglich ist, dass auch hier die Kundenbindung in den Hintergrund rückt und somit ein gültiges Konkurrenzverbot vereinbart werden kann. In der Regel wird bei Vermögensverwaltern nur ein Abwerbeverbot von Kundinnen und Kunden vereinbart.

