«Arbeit und Freizeit sind eine Einheit»
Den Ausdruck Work-Life-Balance hält er für Bullshit. Statt uns immer mehr Freizeit zu wünschen, sollten wir lieber Arbeit finden, die uns erlaubt, uns selbst zu verwirklichen, findet Thomas Vašek in seinem Plädoyer für mehr «gute Arbeit».

Herr Vašek, was hat Sie bewogen, ein Buch mit dem Titel «Work-Life-Bullshit» zu schreiben?
Thomas Vašek: Das klingt provokant und verkauft sich gut (lacht). Nein, im Ernst: Was ich für Bullshit halte, ist die Vorstellung, dass Arbeit und Leben zwei verschiedene Welten sind. In der einen Welt plagen wir uns und mühen uns ab, in der anderen Welt findet das wahre Leben statt und wir können die sein, die wir wirklich sind. Dabei sind die beiden doch eine Einheit. Es gibt auch in der Freizeit Dinge, die wir tun müssen, und genauso gibt es bei der Arbeit Dinge, bei denen wir uns verwirklichen können.
Was passiert, wenn wir Arbeit für unangenehm halten?
Arbeitszeit ist Lebenszeit. Wir verbringen eine Menge Zeit mit Arbeit. Wenn es tatsächlich so wäre, dass Arbeit schlimm ist, dann müssten wir uns eingestehen, dass wir einen erheblichen Teil unseres Lebens vergeuden. Das ist eine ganz simple Feststellung.
Sie charakterisieren Erwerbsarbeit als «gigantische Erfolgsstory»: Wie konnte sie denn dann so in Verruf geraten?
Das ist ein komplexes Phänomen. Auf der einen Seite ist Arbeit ja bereits in vielerlei Hinsicht besser geworden. Früher war sie deutlich gesundheitsschädlicher, und gewisse monotone Industriearbeit gibt es in unseren Breitengraden gar nicht mehr.
Dann müssten wir uns eigentlich freuen …
Jein. Gleichzeitig hat sich eben auch unsere Haltung zur Arbeit verändert. Wir fordern zu Recht von der Arbeit andere Dinge als unsere Grosseltern oder Eltern. Meine Grossmutter beispielsweise arbeitete in einem Lebensmittelgeschäft, stand um 5 Uhr morgens auf und schleppte schwere Milchkannen. Diese Generation hatte nicht so hohe Erwartungen an Arbeit. Sie hielten Arbeit für eine Pflicht, alles andere war undenkbar. Die Generation danach sah Arbeit eher als Mittel zum Zweck, um sich nach 20 Jahren das Einfamilienhäuschen leisten zu können.
Und heute?
Viele Menschen leiden unter einem Gefühl des Missverhältnisses. Die Arbeit macht nicht so viel Spass, wie man sich das vorgestellt hatte. Die Arbeitsformen haben sich verändert, durch Computer und Internet hat sich die Art und Weise, wie wir Arbeit ausüben, verändert, und wir haben noch Schwierigkeiten, uns daran anzupassen. Das gilt für die Unternehmen genauso wie für die Mitarbeiter. Die Herausforderung ist, eine Praxis zu finden, die zwar die Möglichkeit der Technologie nutzt, aber auch menschenwürdig ist.
Was genau stresst denn die Leute?
Was den Menschen heute stresst, ist nicht einfach die Arbeitsüberlastung. Es ist das Problem des Multitaskings, die Annahme, mehrere Dinge gleichzeitig tun zu müssen, bereitet den Menschen Schwierigkeiten.
Sie propagieren in Ihrem Buch die so genannte «gute Arbeit». Was soll das sein?
Zu guter Arbeit gehört eine ganze Menge. Sie braucht beispielsweise belastbare Regeln, Routinen und Rituale. Dazu gehören auch einigermassen geregelte Arbeitszeiten und aus meiner Sicht auch ein Arbeitsplatz – auch wenn man dort nicht immer sein muss. Dank neuer Technologien könnten wir theoretisch zwar überall arbeiten, aber Arbeit ist auch eine zutiefst soziale Aktivität. Das heisst, wir brauchen Kommunikation mit anderen, und per Mail oder Telefon ist es eben nicht das Gleiche wie persönlich. Ein weiteres Kriterium ist darum auch die Kooperation. Die beginnt bei Dingen wie dem Schwätzchen am vielzitierten Kaffeeautomaten. Das scheint trivial, aber ich erachte das als sehr wichtig für gute Arbeit. Mit guter Arbeit können wir uns ausserdem identifizieren, und zwar so, dass unsere Authentizität dabei nicht auf der Strecke bleibt. Das sind nur einige Kriterien.
Gute Arbeit soll zudem Zeiten der Musse beinhalten. Also Nichtstun?
Nicht nichts. Musse heisst nicht, den Nachmittag im Freibad zu verbringen. Musse ist Zeit, in der sich Mitarbeiter aus der Routine zurückziehen und Dinge tun können, die mit dem Alltagsablauf nichts zu tun haben. Kein Mensch kann acht Stunden an fünf Tagen die Woche durcharbeiten wie eine Maschine. Nehmen Sie das Beispiel Google: Die Mit-arbeiter dort haben 20 Prozent ihrer Zeit zur Verfügung, die sie nach eigenem Gutdünken einsetzen können. Das zeigt auch: Musse braucht Struktur.
Was ist mit Selbstbestimmung? Gehört die nicht auch zu guter Arbeit?
Ich glaube nicht, dass Selbstbestimmung ein wichtiges Kriterium für gute Arbeit ist. Wir neigen dazu, sie überzubewerten. Selbstbestimmung ist auch anstrengend. Es möchte nicht jeder autonom arbeiten. Zudem wird Autonomie von Vorgesetzten auch häufig dazu eingesetzt, Verantwortung zu delegieren. Das ist problematisch, denn wenn etwas schiefläuft, sind die Mitarbeiter schuld, obwohl sie laut Hierarchiestufe nicht verantwortlich sind. Leider neigen wir dazu, Arbeitsformen mit wenig oder keiner Selbstbestimmung für schlecht zu halten. Das finde ich falsch. Eine Assistentin zum Beispiel muss zwar tun, was der Chef sagt. Aber sie hat trotzdem gewisse Spielräume, in denen sie ihre Arbeit so tut, wie sie sie für richtig hält. Und obwohl man das nicht als selbstbestimmten Job bezeichnen würde, kann er sehr gut, interessant und erfüllend sein. Das sollten wir uns klarmachen.
Was ist mit den Leuten, die wirklich in miesen Jobs gefangen sind? Denen müssen Ihre Ideen wie Hohn vorkommen.
Ja und nein. Wenn es ist, wie ich behaupte, dass wir gute Arbeit zu einem guten Leben brauchen, dann führen Menschen in schlechten Jobs zu einem grossen Teil ein schlechtes Leben. Wer über Jahre hinweg jeden Tag über seinen Bullshit-Job klagt, hat eine Mitverantwortung und kann sich etwas Neues suchen.
Oder die Rahmenbedingungen ändern …
… wenn das geht. Mir ist bewusst, dass das nicht einfach ist. Es ist nie einfach, ein selbstbewusstes und angstfreies Individuum zu sein. Aber ich glaube, dass Mitarbeiter selbstbewusster sein und zu ihren Chefs gehen und Veränderungen einfordern sollten.
Also braucht es nur etwas Mut?
Ich bin nicht naiv: Mut birgt Überforderung für Menschen. Auf Mut allein können wir nicht setzen, es ist also illusorisch, die Verantwortung dem Einzelnen aufzubürden. Auch die Unternehmen und die Politik haben die Auf-gabe, gute Arbeit zu schaffen. Es sollte den Menschen generell leichter gemacht werden, den Job zu wechseln, ohne in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten.
Ordnen wir uns im Job zu sehr unter?
Viele Leute halten sich zurück, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren. Aber auch die Gewohnheit und die Abneigung gegen Risiken spielen eine grosse Rolle. Selbst wenn wir mehr gewinnen würden, müssen wir das Altbewährte aufgeben. Und interessanterweise fällt uns das auch dann schwer, wenn es sich nicht bewährt hat.
Viele Menschen meinen, nur ohne Arbeit seien sie richtig frei. Sie widersprechen dem. Warum?
Ich halte das für einen Irrtum. Ich kann Verpflichtungen haben – nicht nur bei der Arbeit – und trotzdem frei sein. Aber eben nicht in dem Sinne, dass ich tun kann, was ich will. Aber in dem Sinne, dass ich mich selbst verwirklichen kann. Die meisten Menschen haben eine Vorstellung davon, wie ihr Leben aussehen soll und was sie erreichen wollen. Etwas, für das es sich zu leben lohnt – und für das es sich eben auch lohnt, sich anzustrengen. Auch wenn man vielleicht gerade keine Lust hat. Insofern gibt Arbeit uns einen Grund, etwas zu tun. Und zwar unabhängig von unserem derzeitigen Wunsch. Das ist übrigens in der Liebe ganz ähnlich: Wir haben auch nicht immer Lust, dem anderen zu helfen oder -etwas für ihn zu tun. Doch die Liebe schafft einen Grund, der wichtiger ist als unser momentaner Wunsch.
Buchtipp
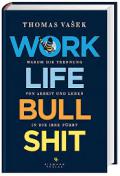 Thomas Vašek
Thomas Vašek
Work LifeBullshit – Warum die Trennung von Arbeit und Leben in die Irre führt
Riemann Verlag, 2013